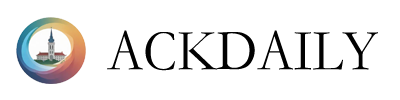FOCUS online: Herr Böse, die Ampel ist Geschichte. Was erwarten Sie von einer neuen, von Friedrich Merz geführten schwarz-roten Regierung?
Gerald Böse: Die letzten Jahre waren geprägt von Uneinigkeit und politischen Konflikten innerhalb der Regierung. Das war oft eine große Qual und eine Herausforderung für Unternehmen, weil Planbarkeit und Verlässlichkeit gefehlt haben. Für die Wirtschaft ist es entscheidend, dass politische Rahmenbedingungen stabil und berechenbar sind. Ich hoffe, dass sich Schwarz-Rot unter Merz schnell darauf konzentriert, ein wirtschaftsfreundlicheres Umfeld zu schaffen. Unternehmen brauchen klare Signale, dass Investitionen sich langfristig lohnen.
Welche drei Dinge sollte Merz als Erstes tun?
Böse: Erstens muss er kurzfristig wirtschaftspolitische Maßnahmen ergreifen, um den Standort Deutschland wieder attraktiver zu machen. Dazu gehören steuerliche Anreize für Investitionen und der Abbau von Bürokratie. Zweitens muss er das Thema innere Sicherheit und illegale Migration angehen. Spätestens seit der Wahl muss allen Parteien der demokratischen Mitte klar sein, dass es ein klares Votum der deutschen Bevölkerung gibt: Diejenigen, die unrechtmäßig hier sind, die sich nicht integrieren wollen oder straffällig werden, müssen unser Land wieder verlassen. Die Menschen wollen sehen, dass der Staat handlungsfähig ist. Drittens muss Merz in Europa wieder als starker und berechenbarer Partner auftreten und den Ausbau von Handelsabkommen vorantreiben.
Mehr aus dem Bereich Wirtschafts-News
Meistgelesene Artikel der Woche
Muss die neue Regierung auch mit großen Investitionspaketen auf Wirtschaftskrise und angespannte Sicherheitslage reagieren?
Böse: Staatlich gelenkte Großinvestitionen sind sicherlich notwendig – zum Beispiel für die Sanierung der maroden Infrastruktur und für die Wehrfähigkeit der Bundeswehr. Dennoch muss grundsätzlich gelten: Der Staat sollte als ordnender Akteur auftreten, nicht als Unternehmer.
Wie gefährlich wird Donald Trump für die deutsche Wirtschaft?
Böse: Trump hat gerade bei dem Eklat um den Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gezeigt, dass mit ihm als verlässlicher Partner nicht mehr zu rechnen ist. Er verfolgt eine ausschließlich an den Interessen der USA ausgerichtete Politik. Die Welt, wie wir sie lange kannten, mit starken transatlantischen Beziehungen und den USA als Schutzschild für Europa, gibt es so nicht mehr. Wirtschaftspolitisch versucht Trump offenbar, Russland von China zu lösen, um Chinas Einfluss zu begrenzen. Für Europa heißt das umso mehr: Wir dürfen uns nicht spalten lassen. Die Europäische Union ist der größte Binnenmarkt der Welt, mit über 500 Millionen Verbraucherinnen und Verbrauchern. Diese EU braucht aber eine neue Agenda 2035, sowohl wirtschafts- wie sicherheitspolitisch. Das ist eine weitere, gewaltige Aufgabe für Friedrich Merz. Deutschland muss wieder führen in Europa.
Kritiker haben der abgelösten Ampel schlechtes Regierungshandwerk und – mit Blick auf die Grünen – zu viel Ideologie vorgeworfen. Teilen Sie diese Einschätzung?
Böse: Es gab Entscheidungen, die überstürzt oder schlecht kommuniziert wurden, wie das Heizungsgesetz. Das hat bei vielen Unternehmen und Bürgern für Verunsicherung gesorgt. Gleichzeitig müssen wir aber anerkennen, dass Deutschland es geschafft hat, trotz des russischen Gasstopps im ersten Winter nicht in eine Energiekrise zu geraten. Wir haben nicht gefroren, als Putin uns das Gas abgestellt hat. Hier hat die Ampel auch wichtige Weichen gestellt. Entscheidend ist, dass die neue Regierung wirklich Lösungen für die Sorgen und Probleme der Bevölkerung und auch der Wirtschaft anbietet. Gelingt das nicht, dann sehe ich die nächste Wahl in vier Jahren sehr kritisch. Dann werden die extremen Ränder noch einmal zulegen.
Wie schnell muss die neue schwarz-rote Regierung stehen?
Böse: Besser heute als morgen! Deutschland ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, wir können es uns nicht leisten, in politischen Stillstand zu verfallen. Die Herausforderungen sind so enorm, dass spätestens bis Ostern die neue Regierung ihre Arbeit aufnehmen muss. Gerade die deutsch-französische Zusammenarbeit muss wieder gestärkt werden, um Europa als Wirtschafts- und Innovationsstandort konkurrenzfähig zu halten. Nach dem Brexit fehlt ein wichtiger Player, deshalb müssen Deutschland, Frankreich und Italien enger zusammenarbeiten.
Die Koelnmesse hat Standorte im Ausland, Sie sind viel in der Welt unterwegs. Wie wird Deutschland international wahrgenommen?
Böse: Deutschland hat derzeit das schwächste Wirtschaftswachstum unter den G7-Staaten. Das hinterlässt Spuren. Unsere Ingenieurskunst und der Maschinenbau genießen noch Ansehen, aber andere Länder haben in den letzten Jahren enorm aufgeholt. Viele fragen sich, ob Deutschland wirtschaftlich noch die gleiche Strahlkraft hat wie früher. Insbesondere unsere Defizite bei Digitalisierung und Infrastruktur fallen im internationalen Vergleich negativ auf. Die Fußball-EM hat das eindrucksvoll vor Augen geführt. Trotzdem traut man uns zu, wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Deutschland ist angeschlagen, aber man traut uns ein Comeback zu.
Als Chef einer der größten Messen in Deutschland führen Sie viele Gespräche mit Unternehmen und Firmen, die bei Ihnen ausstellen. Was hören Sie von denen?
Böse: Die Stimmung ist angespannt. Viele Unternehmen klagen über Fachkräftemangel, hohe Energiekosten und zu viel Bürokratie. Besonders der Mittelstand steht unter Druck. Das sehen wir auch direkt: Viele Unternehmen sparen an Marketingbudgets, was sich auf Messen auswirkt. Die Kosten für Messeteilnahmen sind stark gestiegen, weil Standbau, Reisen und Personal teurer geworden sind. Das führt dazu, dass einige Unternehmen kleinere Flächen buchen oder sich ganz gegen eine Teilnahme entscheiden. Wir mussten deshalb schwierige Entscheidungen treffen, wie die Aussetzung der Internationalen Möbelmesse IMM Cologne 2025.
Droht Deutschland eine Deindustrialisierung?
Böse: Das ist längst nicht mehr nur eine Gefahr – dieser Prozess ist real und in vollem Gange. Viele Unternehmen investieren nicht mehr in Deutschland, sondern in Osteuropa, Asien oder in den USA. Das ist ein klares Signal, dass die Standortbedingungen hier nicht mehr attraktiv genug sind. Das heißt nicht, dass Unternehmen sofort Produktionsstätten schließen, aber der langfristige Trend ist bedenklich. Die Politik muss jetzt sofort gegensteuern, indem sie Standortnachteile abbaut und die Wettbewerbsfähigkeit erhöht. Sonst erodiert der industrielle Kern Deutschlands.
Die Pandemie hat viele Messen hart getroffen. Wie geht es der Koelnmesse heute?
Böse: Wir haben die Corona-Krise gemeistert, aber sie hat Spuren hinterlassen. Im Jahr 2024 haben wir unser 100-jähriges Jubiläum gefeiert und konnten mit 365 Millionen Euro Umsatz und 20 Millionen Euro Gewinn wieder sehr positive Zahlen schreiben. In der Pandemie haben wir 260 Millionen Euro Verlust gemacht. Nun geht es darum, Schulden abzubauen und gleichzeitig in die Zukunft zu investieren. Bis 2040 planen wir über eine Milliarde Euro in die Modernisierung unseres Messegeländes in Köln zu stecken. Gleichzeitig wachsen wir international: In den letzten fünf Jahren haben wir weltweit 16 neue Messen im Ausland ins Leben gerufen, neun weitere kommen bald hinzu. Die Nachfrage vieler Mittelständler, die über uns ihren Markteintritt im Ausland planen oder ihre Umsatzbasis durch weltweite Kunden auf Auslandsmessen breiter aufstellen wollen, ist enorm.
Infokasten
An den weltweit 76 Veranstaltungen der Koelnmesse 2024 beteiligten sich über 34.500 ausstellende Unternehmen aus 106 Ländern und mehr als 2,1 Millionen Besucherinnen und Besucher aus 197 Ländern. Von den 76 Veranstaltungen im Jahr 2024 setzte die Koelnmesse 29 im Ausland um.
Jeder zweite Besucher lernt die Koelnmesse inzwischen auf einer ihrer Messen im Ausland kennen – von ihren über zwei Millionen Gästen aus der ganzen Welt ist 2024 etwas mehr als die Hälfte nach Köln gereist, die andere Hälfte hat eine der Auslandsmessen besucht.
Bei den Ausstellern liegt der Messeplatz Köln vorn: Rund 63 Prozent aller Unternehmen, die Kunden der Koelnmesse sind, haben 2024 ihren Messestand in Deutz aufgebaut; 37 Prozent der Aussteller gehen mit der Koelnmesse auf einen ihrer ausländischen Ableger.