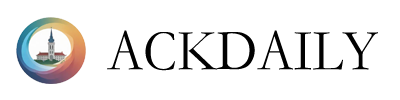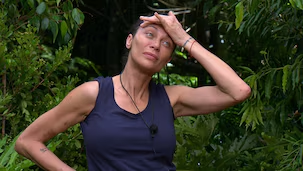+++ Der Welt-Klima-Ticker +++
Klima-Fakt des Tages: Ein kritischer Blick auf Lithium-Ionen-Batterien zeigt deren Schattenseiten
Freitag, 30. August, 12.30 Uhr: Lithium-Ionen-Batterien haben die Energiespeicherung in den letzten Jahren revolutioniert, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien. Doch trotz ihrer weit verbreiteten Verwendung gibt es auch einige bedeutende Nachteile.
Erstens sind die Rohstoffe für Lithium-Ionen-Batterien, insbesondere Lithium und andere seltene Erden, begrenzt und mit erheblichen ökologischen und sozialen Kosten verbunden. Zweitens sind Kosten und Speicherdauer ein weiteres Problem. Lithium-Ionen-Batterien sind am effektivsten bei kurzen Speicherdauern von bis zu vier bis sechs Stunden. Für längere Zeiträume werden die Kosten deutlich höher. Drittens gibt es Sicherheitsbedenken. Lithium-Ionen-Batterien können in bestimmten Fällen überhitzen oder Feuer fangen, was die Notwendigkeit von Sicherheitsvorkehrungen erhöht und die Komplexität und Kosten ihrer Nutzung weiter steigert.
Lösungsansatz: Mit neuen Erd-Batterien lösen US-Startups großes Problem der Energiewende
Drei Startups aus Houston, darunter Sage Geosystems, entwickeln fracking-ähnliche Techniken, um unterirdische Druckwasserspeicher zu schaffen und so erneuerbare Energien effizienter zu speichern – ganz ohne Lithium-Batterien. Das Prinzip: Überschüssige Energie aus Solar- und Windkraft wird verwendet, um Wasser in unterirdische Höhlen zu pumpen. Bei Bedarf wird das unter Druck stehende Wasser freigesetzt und treibt Turbinen an, die Strom erzeugen.
Sage Geosystems kündigte in einer Pressemitteilung im August nun das „Geopressurized Geothermal System“ an – das „erste geothermische Energiespeichersystem“. Es soll Energie tief in der Erde speichern und Strom ins Netz einspeisen. „Wir nennen es eine Erd-Batterie“, erklärt Sage Geosystems Wissenschaftler Mike Eros. Es soll in Südtexas neben einer Solaranlage installiert werden. Mit einem Speicherpotenzial von bis zu zehn Stunden und einer Effizienz von 75 Prozent könnte die Methode eine günstige Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien darstellen.
Forscher und Investoren blicken gespannt auf das erste kommerzielle Projekt in Texas. Letztlich hängt die wirtschaftliche Rentabilität des Systems davon ab, wie sich ihre Kosten im Vergleich zu Lithium-Ionen-Batterien entwickeln. Sollte es erfolgreich sein, könnte die geothermische Energiespeicherung in Zukunft eine wichtige Rolle in der globalen Energiewende spielen.
Klima Good News des Tages: Landwirt nutzt Klee und Humus als CO2-Speicher
Mittwoch, 28. August, 14.23 Uhr: Der Klimawandel stellt die Landwirtschaft vor große Herausforderungen, doch innovative Lösungen wie der Humusaufbau könnten Abhilfe schaffen. So setzt Landwirt Matthias Ertl aus Oberhaching seit eineinhalb Jahren auf den Anbau von Klee statt Silomais, um die Kohlenstoffdioxid-Bindung seiner Felder zu maximieren. Unterstützt wird er dabei von der Initiative „Aktion Zukunft Plus“ des Landkreises München, welche Landwirte bei nachhaltigen Projekten finanziell fördert.
Humus, der durch den Anbau von Klee entsteht, ist ein natürlicher CO2-Speicher. Humus habe viele Vorteile. Er verbessere die Bodenfruchtbarkeit, speichere Wasser und helfe Pflanzen, extreme Wetterbedingungen besser zu überstehen, erklärt Anna Dufner von der Energieagentur München-Ebersberg im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Für Ertl bedeutet dies jedoch auch, auf wirtschaftlich rentablere Pflanzen wie Mais zu verzichten – eine Entscheidung, die er ohne die Förderung von 600 Euro pro Hektar jährlich nicht treffen könnte.
Finanziert wird die „Aktion Zukunft Plus“ durch ein Crowdfunding-Modell. Unternehmen und Privatpersonen können Zertifikate erwerben, die für jede eingesparte Tonne CO2 stehen. Bislang wurden über 2000 dieser Zertifikate verkauft. Ertl plant, seine Landwirtschaft weiter auf ökologische Methoden umzustellen, um noch mehr CO2 zu binden und die Umwelt zu schützen.
Klima-Fakt des Tages: Dürre und Wasserknappheit bedrohen Landwirtschaft und Krankenhäuser
Dienstag, 27. August, 15.06 Uhr: Der bisherige Sommer in Deutschland war regnerisch, doch in den vergangenen Jahren litt das Land häufig unter Dürre-Problemen. Probleme, die in Zeiten des Klimawandels größer werden. Bereits jetzt sinkt in Teilen Deutschlands – langsam, aber kontinuierlich – der Grundwasserspiegel. Darunter leidet etwa die Landwirtschaft, aber auch Wasserwerke, die vereinzelt bereits dazu gezwungen waren, ihre Pumpen abzuschalten. Auch kritische Infrastrukturen wie Kraftwerke und Dialysezentren in Krankenhäusern waren bereits durch die Wasserknappheit bedroht.
Lösungsansatz: Abwasser-Recycling als Schlüssel gegen Wasserknappheit
Die Lösung für das Dürre-Problem könnte im Abwasser liegen – genauer gesagt im Recycling von Abwasser. In einigen Regionen der Welt, darunter El Paso in Texas oder Windhuk in Namibia, wird Abwasser bereits in Trinkwasser umgewandelt. Möglich machen das Technologien wie die Aktivkohlefiltration oder die UV-Desinfektion.
In Deutschland stehen diese Technologien noch am Anfang, denn das „Schmutz-Image“ von Abwasser verhindert bisher eine breite Akzeptanz. Ein Bereich, in dem recyceltes Wasser seit einer entsprechenden EU-Verordnung im Jahr 2023 bereits genutzt werden darf, ist die Landwirtschaft.
Um in Zukunft Abwasser auch trinkbar zu machen, versuchen aktuell Forschende der TU München im Rahmen des Projekts TrinkWave schwer abbaubare Schadstoffe im Wasser durch Mikroorganismen zu entfernen. Dieses sogenannte SMART-Verfahren wurde auf der Insel Baumwerder in Berlin bereits erfolgreich erprobt und könnte insbesondere in kommunalen Klärwerken eingesetzt werden.
Die Kosten für die Implementierung einer Anlage mit SMART-Technologie variieren je nach Größe, doch die Betriebskosten pro Kubikmeter behandeltem Abwasser sind wettbewerbsfähig im Vergleich zu herkömmlichen Methoden. Und: Dank der Rückgewinnung von Ressourcen wie Phosphor und Biogas können die Kosten sogar weiter gesenkt werden. So könnten in gut betriebenen Kläranlagen umweltfreundlich und kostengünstig nahezu 100 Prozent des eingehenden Abwassers in nutzbares Wasser umgewandelt werden. Derzeit wird die großtechnische Umsetzung auf dem Standort des ehemaligen Wasserwerks in Berlin-Johannisthal erprobt.
Klima Good News des Tages: Nasser Sommer reduziert Waldschäden um tausende Hektar
Montag, 28. August, 14.11 Uhr: Nach mehreren trockenen Jahren hat der diesjährige Sommer dringend benötigte Entlastung für die Natur gebracht. Besonders die Wälder in Hessen, die in den vergangenen Jahren stark unter den Trockenperioden gelitten hatten, konnten sich durch die Niederschläge erholen. Christian Raupach vom hessischen Waldbesitzerverband berichtet gegenüber der FAZ, dass der Sommerregen eine Pause von den Schäden der letzten fünf Jahre ermöglicht hat. Die Auffüllung des Grundwassers und das Wachstum neuer Feinwurzeln haben die Bäume widerstandsfähiger gegenüber Krankheiten und Schädlingen gemacht. Besonders junge, neu gepflanzte Bäume profitierten vom feuchten Wetter, das ihnen einen kräftigen Wachstumsschub im Juni verschaffte.
Trotz der sichtbaren Erholung ist der Waldschaden jedoch noch nicht vollständig behoben. Satellitenbilder zeigen, dass die Schadensfläche von tausenden Hektar auf einige hundert reduziert werden konnte. Aber um das Defizit der vergangenen Jahre auszugleichen, wären weiterhin überdurchschnittliche Niederschläge notwendig, erklärt der Experte.
Laut Deutschem Wetterdienst, war der Zeitraum von Juli 2023 bis Juni 2024 der nasseste in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881.
Klimafreundlichere Schifffahrt: So speichert Calcareas Technologie Treibhausgase im Meer
Donnerstag, 22. August, 10.39 Uhr: Ein neues Projekt des US-Unternehmens Calcarea könnte die Schifffahrtsindustrie revolutionieren und dabei helfen, ihre CO2-Emissionen drastisch zu reduzieren. Das Unternehmen entwickelt eine Technologie, die Kohlendioxid aus den Abgasen von Frachtschiffen entfernt und es in Form von Bikarbonatsalzen im Ozean speichert.
Und so funktioniert das laut CNN konkret: Frachtschiffe stoßen durch das Verbrennen von Treibstoff CO2 aus. Dieses CO2 wird in einem speziellen Reaktor an Bord des Schiffes durch eine Mischung aus Meerwasser und Kalkstein geleitet. Kalkstein ist ein natürliches Gestein, das viel Kalziumkarbonat enthält – das gleiche Material, aus dem Muscheln und Korallen bestehen.
Wenn das CO2 mit dieser Mischung in Berührung kommt, verwandelt es sich in eine andere chemische Form, die als Bikarbonatsalze bekannt ist. Diese Salze sind stabil und sicher, sodass das umgewandelte CO2 im Meerwasser gelagert werden kann, ohne der Umwelt zu schaden. Das Ergebnis ist, dass das CO2, anstatt in die Atmosphäre zu gelangen und zur Erderwärmung beizutragen, sicher im Ozean gespeichert wird.
Das Verfahren ist eine beschleunigte Version eines natürlichen Prozesses, der ohnehin in den Ozeanen abläuft. Dank Calcareas Technologie kann der Vorgang in Minuten geschehen, statt über Tausende von Jahren.
Der chemische Ozeanograph Jess Adkins, Gründer von Calcarea und Professor am California Institute of Technology, sieht in der Methode einen vielversprechenden Weg, um die Klimaziele der Schifffahrtsindustrie zu erreichen. Calcarea hat bereits zwei Prototypen entwickelt und eine Partnerschaft mit dem Schifffahrtsunternehmen Lomar geschlossen. Die Kosten belaufen sich derzeit auf etwa 100 Dollar pro Tonne erfasstem CO2.
Weitere Nachrichten zum Thema Klima finden Sie hier.
cba, flr, sth, vst