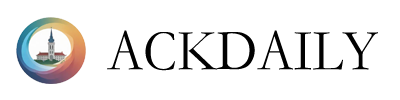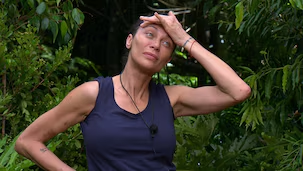Marine Le Pen steht wegen mutmaßlicher Veruntreuung von EU-Geldern vor Gericht. Am 31. März soll das Urteil verkündet werden. Was droht Le Pen?
Neben einer Freiheits- und Geldstrafe fordert die Staatsanwaltschaft, dass Le Pen fünf Jahre lang nicht bei Wahlen antreten darf. Sie fordert zudem eine sogenannte „exécution provisoire".
Das heißt: Die Strafe würde sofort wirksam werden, ein Berufungsprozess hätte keine aufschiebende Wirkung. Ein richterliches Aus für Le Pen würde ein politisches Erdbeben auslösen.
Zwar hat Frankreich bereits zahlreiche spektakuläre Prozesse gegen führende Politiker erlebt – etwa gegen Jacques Chirac oder Nicolas Sarkozy –, diese fanden jedoch stets erst nach deren politischem Rückzug statt. Bei Le Pen hingegen würde erstmals eine aktive Spitzenpolitikerin gestoppt. Sicher ist: Der Rassemblement National würde ein solches Urteil umgehend anfechten und die Unparteilichkeit der Justiz in Zweifel ziehen – mit weitreichenden Folgen für das Vertrauen in die Institutionen und die Wahrnehmung der Justiz. Le Pen selbst hat bereits den Boden dafür bereitet: So sprach sie Ende November im Sender TF1 von einem „schwerwiegenden Angriff auf die Demokratie“, sollte es zu einer solchen Entscheidung kommen. Wenige Wochen später legte sie nach und erklärte, sie könne sich „nicht vorstellen, dass Richter beschließen, dem französischen Volk die Wahl seines Präsidentschaftskandidaten zu verweigern.“
Mehr aus dem Bereich Ausland
Meistgelesene Artikel der Woche
Über Landry Charrier
Landry Charrier ist Mitglied der CNRS-Forschungseinheit SIRICE (Sorbonne, Paris), Associate Fellow am Global Governance Institute (Brüssel) sowie am Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn). Seine Schwerpunkte sind die deutsch-französischen Beziehungen im globalen Kontext sowie Frankreichs Außen- und Sicherheitspolitik. Er ist Ko-Produzent des Frankreich-Podcasts Franko-viel und seit März 2023 Redaktionsleiter der deutsch-französischen Zeitschrift dokdoc.
Warum stellt sich Jean-Luc Mélenchon hinter Marine Le Pen?
Dass Jean-Luc Mélenchon, der Anführer der französischen Linken, sie gerade an der Stelle unterstützt, mag auf den ersten Blick überraschen – doch dahinter steckt ein klares Kalkül: Bei einer Präsidentschaftswahl werden die Parteien der Mitte und die Konservativen kaum in der Lage sein, sich auf einen einzigen Kandidaten zu einigen. Die Folge: Ihre Stimmen werden sich auf mehrere Kandidaten verteilen, während der Nouveau Front Populaire (wenn das Linksbündnis weiterhin so heißt) und der Rassemblement National mit jeweils einem bzw. einer Kandidatin ins Rennen gehen.
Beide Blöcke werden sich dann in der Stichwahl gegenüberstehen. Die Alternative hieße dann: Mélenchon oder Le Pen. Seine Hoffnung: Dass die meisten Franzosen sich am Ende für ihn entscheiden – nicht aus Überzeugung, sondern weil sie ihn als das „kleinere Übel“ sehen.
Wie könnte sich die innenpolitische Situation nun entwickeln?
Die am 16. März von Premierminister François Bayrou getroffene Entscheidung, die Diskussion über eine mögliche Rückkehr zur Rente mit 62 zu beenden, dürfte in den kommenden Wochen für heftige Diskussionen sorgen. In seiner Regierungserklärung am 14. Januar hatte Bayrou angekündigt, der zu diesem Zweck eingerichteten „Konklave“ bis Ende Mai Zeit zu geben, ihm Vorschläge zu unterbreiten. Auf dieser Basis wolle man dann prüfen, wo nachjustiert werden könne.
Doch nun stellt sich die Lage völlig anders dar: Als Reaktion auf die erratische Politik des amerikanischen Präsidenten hat Emmanuel Macron am 5. März angekündigt, Frankreichs Rüstungsausgaben drastisch erhöhen zu wollen. In diesem Kontext, so Bayrou, sei eine erneute Debatte über das Renteneintrittsalter hinfällig geworden: Der Staat könne es sich schlichtweg nicht leisten. Vieles spricht dafür, dass La France Insoumise nun versuchen wird, die Situation zu eskalieren und die Protestbewegungen aus dem Frühjahr 2023 neu aufzurollen – und das ausgerechnet zum Zeitpunkt, zu dem eine Verurteilung Marine le Pens für landesweite Wut sorgen könnte. Eine explosive Mischung, die Frankreich (wieder einmal) ins Chaos stürzen würde.
Die internationale Lage spitzt sich zu. Wie reagiert der Rassemblement National darauf?
Der Rassemblement National hat sich in den vergangenen 2,5 Jahren wenig zu außenpolitischen Fragen geäußert. Für eine Partei, die über Jahre hinweg enge Beziehungen zum Putin-Regime gepflegt hat, wäre das Risiko, öffentlich in Kontroversen verwickelt zu werden, viel zu groß gewesen.
Als Marine Le Pen im Juni 2023 vor einer Untersuchungskommission zu ihren Russlandverbindungen befragt wurde und sie sich nochmal zur Annexion der Krim äußern musste, konnte sie nur mit Mühe den Schaden von sich wenden.
Beim Tod von Alexei Nawalny (16. Februar 2024) konnte ihr jeder ansehen, wie schwer es ihr fiel, öffentlich Position zu beziehen. Das hat sie am Ende gemacht, ohne allerdings von „Mord“ zu sprechen: Das klang alles andere als überzeugend. Solche Situationen galt es von nun an zu vermeiden, denn am Ende konnten sie dem Image schaden, das sie sich über die Jahre gebaut hat. Doch nun hat sich die Situation geändert.
Die Außenpolitik drängt nahezu alle anderen Themen in den Hintergrund. Eine Partei, die den Anspruch erhebt, an die Macht zu kommen, kann nicht umhin, sich dazu äußern – zumal Emmanuel Macron auf einmal wieder im Fokus der Aufmerksamkeit steht. Infolge der Parlamentswahl war er innenpolitisch angeschlagen, außenpolitisch kaum noch handlungsfähig (weil nicht mehr glaubwürdig). Nun ist es ihm gelungen, seine Legitimität als Anführer Europas zurückzugewinnen: durch intensive Gespräche mit allen Parteivorsitzenden und Abstimmungsrunden mit allen europäischen Staats- und Regierungschefs. Seine Zustimmungswerte haben sich erholt, das dürfte Marine Le Pen nicht gefallen.
Welche Optionen hat Marine Le Pen?
Marine Le Pen hat kürzlich versucht, die Bedrohung durch Russland herunterzuspielen – „Die größte Bedrohung für unser Land ist heute der islamistische Terrorismus“, sagte sie am 10. März. Diese Sichtweise wird jedoch nicht von der Mehrheit der Franzosen geteilt, wie eine aktuelle Umfrage zeigt.
Bleibt also nur noch ein Weg: Innen- und Außenpolitik miteinander zu verknüpfen. An diese Strategie hat die Partei bereits letztes Jahr angesetzt, als Frankreichs Landwirte ihren Unmut gegen das Mercosur-Freihandelsabkommen auf die Straße trugen. Die Proteste lieferten dem Rassemblement National die Argumente, die er benötigte, um sich zum EU-Beitritt der Ukraine zu positionieren. Bis dahin hatte sich Marine Le Pen in dieser Frage weitgehend zurückgehalten. Ihr Nein begründete sie nicht mit geostrategischen Erwägungen, sondern mit wirtschaftlichen Argumenten: Ein Beitritt der Ukraine würde den Tod der französischen Landwirtschaft bedeuten – und den Zusammenbruch ganzer Wertschöpfungsketten nach sich ziehen. Dass der Rassemblement National dieses Thema in den Mittelpunkt rückte, mag überraschen. Doch Umfragen zeigten damals, dass 90 Prozent der Franzosen hinter den Bauernprotesten standen.
Le „monde paysan“ hat schon immer einen besonderen Platz in der großen nationalen Erzählung eingenommen. Daran hat sich bis heute nichts geändert – trotz ihres geringen Anteils am BIP, ca. 1,7 Prozent. Doch inzwischen hat das Thema an Sichtbarkeit verloren. Marine Le Pen braucht ein neues „Instrument der Wut“. Auch ihr könnte die Aussetzung der Diskussionen über eine mögliche Rückkehr zur Rente mit 62 in die Hände spielen. Noch hat sie sich nicht dazu positioniert, aber das Narrativ liegt auf der Hand: „Der Präsident verfolgt einen Kurs, der den Krieg in der Ukraine verlängert und Frankreichs Kassen zusätzlich belastet. Jetzt sollen Sie die Rechnung dafür zahlen.“
Und hier sprechen die Umfragen eine deutliche Sprache: Eine große Mehrheit der Franzosen ist nach wie vor der Meinung, dass die von Élisabeth Borne durchgesetzte Rentenreform rückgängig gemacht werden muss. Am Ende wird vieles davon abhängen, ob es zu einer „Bündelung der Wut“ kommt. Zwar wollen beide Blöcke – Nouveau Front Populaire (mit oder ohne die Sozialisten) und Rassemblement National – offiziell nichts miteinander zu tun haben. Dennoch sind sie aufeinander angewiesen: Ohne die Unterstützung des jeweils anderen wird der von ihnen angestrebte politische Umbruch nicht gelingen.
Dieser Content stammt aus unserem EXPERTS Circle. Unsere Experts verfügen über hohes Fachwissen in ihrem Bereich. Sie sind nicht Teil der Redaktion.