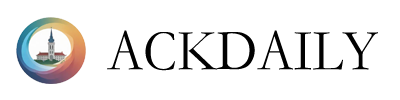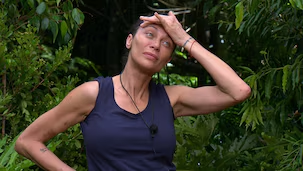Meistgelesene Artikel der Woche
earth
FOCUS online Earth widmet sich der Klimakrise und ihrer Bewältigung.
Faktenzentriert. Fundiert. Konstruktiv. Jeden Freitag als Newsletter.
Rechtstext wird geladen...
Der finale Plan der Ampel hatte die anvisierte Leistung daher halbiert: Im schlussendlich formulierten „Kraftwerksicherheitssgesetz" sollten es dann noch 12.500 Megawatt sein, also die Hälfte. Das Gesetz war ursprünglich eines der dringendsten Projekte aus dem Wirtschaftsministerium von Robert Habeck, hatte sich aber in seinen drei Jahren Amtszeit immer wieder verzögert. Als der Gesetzestext dann Ende 2024 endlich stand, war die Ampel schon auseinandergebrochen – und das Gesetz hatte keine Mehrheit mehr. Denn weder die FDP noch die Union wollten mitmachen.
„Gaskraftwerke von der Stange"
Warum die Union die Zustimmung zu einem Vorhaben verweigerte, das sie selbst für wichtig hielt – dazu gab es innerhalb der Partei verschiedene Begründungen. Das Thema sei hochkomplex und die Union sei nie eingebunden gewesen, sagte Mark Helfrich, energiepolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, im November dem Fachportal Energate. Daher sei eine Zustimmung „de facto ausgeschlossen", man wolle die Frage aber in der kommenden Legislaturperiode „mit höchster Priorität“ angehen.
Fraktionsvize Jens Spahn wiederum attackierte den Habeck-Entwurf als „teuerste und langsamste aller Lösungen“. Man brauche die Gaskraftwerke nicht wasserstofffähig bauen, sagte Spahn Anfang Dezember der „Rheinischen Post". „Gaskraftwerke von der Stange lassen sich schnell und günstig bauen und nachträglich klimaneutral mit CCS-Technik ausrüsten". Mit der CCS-Technologie lässt sich erzeugtes CO2 wieder einfangen und zum Beispiel unter der Erde speichern. Bislang ist die Technik aber noch zu teuer für einen Einsatz in der Praxis.
Angst vor der nächsten Dunkelflaute
In einer Sache ist man sich in Unionskreisen allerdings einig: Der Gaskraftwerke-Plan müsse größer gedacht werden als bislang, gleichzeitig müsse es schneller gehen als die anvisierten fünf Jahre. Man dürfe nicht zulassen, dass Dunkelflauten zunehmend die Akzeptanz der Energiewende gefährden, heißt es in der Partei.
Der Kraftwerks-Plan dürfte daher auch zum heißdiskutierten Gegenstand der Sondierungen mit der SPD werden. Die Sozialdemokraten nahmen es mit Bedauern auf, dass die Union Ende letzten Jahres dem ursprünglichen Gesetzesentwurf nicht zustimmen wollte. Kurz vor Beginn der Koalitionsverhandlungen mehrte sich aber die Kritik am Merz-Plan mit den 50 Kraftwerken. Braucht es wirklich so viele?
„Die teuren Strompreise würden nochmal höher"
Viele Expertinnen und Experten glauben: Nein. „Da kommt viel Nonsens dabei herum, weil es mit der Realität, wie die Energiepolitik geführt werden wird, überhaupt nichts zu tun hat", sagte der Energieökonom Matthias Mier vom Ifo-Institut am Mittwoch dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR). Mit dem bisherigen Vorrat an Gaskraftwerken könne man „recht lang überleben", so Mier. Wichtiger sei es, in Batteriespeicher zu investieren.
„Mit Gaskraftwerken Strompreise senken zu wollen, funktioniert meiner Ansicht nach nicht", sagte Sebastian Bolay, Bereichsleiter Energie, Umwelt, Industrie bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), ebenfalls dem MDR. Es sei auch sehr teuer, 50 Gaskraftwerke zu bauen, die Kosten müsste nach EU-Recht auf die Verbraucherinnen und Verbraucher umgelegt werden. „Das heißt, die teuren Strompreise, die wir sowieso schon haben, würden durch die neue Umlage nochmal höher", sagt Bolay. „Intern rechnen wir mit ein bis zwei Cent die Kilowattstunde."
Überraschende Ankündigung
Auch in der Energiebranche herrscht Skepsis, wie schnell sich der Merz-Plan umsetzen ließe. Der Energiekonzern RWE wolle drei Gigawatt Gaskraftwerke bis 2030 bauen – das sei immer noch möglich, sagte RWE-Chef Markus Krebber Mitte Februar dem Branchendienst Montel. Aber bei 50 Gaskraftwerken, so Krebber, „reden wir wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum von mehr als einer Dekade."
Tatsächlich waren auch bei der Kraftwerksstrategie der Ampel seit jeher viele Fragen offen: Wie lässt sich ein marktwirtschaftlicher Betrieb von Gaskraftwerken gewährleisten, die so selten wie möglich kaufen sollen? Wie sinnvoll ist es, die Umrüstung auf Wasserstoff zur Bedingung zu machen, wenn diese in der Praxis noch kaum erprobt ist? Und wie viele Kraftwerke braucht es, wie hoch ist die Gefahr von Überkapazitäten?
Auch in der Union zerbricht man sich über diese und weitere Fragen noch den Kopf. Einigkeit herrscht offenbar noch keine: Ein CDU-Sprecher sagte am Mittwoch dem MDR, die 50 neugebauten Kraftwerke sollten auch „wasserstofffähig" sein – also das Gegenteil von dem, was Fraktionsvize Spahn im Dezember gefordert hatte.
+++ Keine Klima-News mehr verpassen - abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal +++