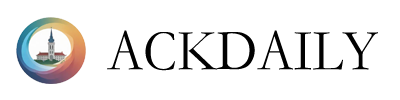Es hat gedauert: Seit Jahren gibt es Elektroautos mit einer Spannungsebene von 800 Volt, doch von deutschen Herstellern konnten das bislang nur Porsche und Audi liefern. In diesem Jahr legen nun BMW mit der "Neuen Klasse" und Mercedes endlich nach. Der vor anderthalb Jahren auf der IAA in München als Studie gezeigte CLA ist natürlich nur ein Ableger auf einer Basis, auf der Mercedes eine Reihe von Modellen hochziehen wird. Zusätzlich zur Limousine und einem Kombi, der nicht mehr so heißen darf, werden auch SUVS diese Plattform nutzen. Wir konnten kurz vor der offiziellen Vorstellung bereits ein paar Runden mit dem CLA der nächsten Generation drehen.
800 Volt: Warum ist das wichtig?
Mit der Verdopplung der Spannung auf 800 Volt eröffnet sich die Chance auf deutlich höhere Ladeleistungen als bisher. Die Spannungserhöhung allein ist dafür zwar noch kein Garant, liefert aber gewissermaßen die Vorlage. Ohne eine Erhöhung der Stromstärke kann so die Leistung steigen. Da viele Ladesäulen nur 500 A liefern, ist mit einem 400-Volt-System bei 200 kW Schluss. Mit 800 Volt sind 350 kW und mehr möglich. Ob die Batterie und ihre Peripherie im jeweiligen Auto das dann mitmacht – und unter welchen Bedingungen – steht auf einem anderen Blatt. Auf absehbare Zeit wird ein Hersteller, der sich zur Spitzengruppe zählen möchte, deutlich mehr als 250 kW liefern müssen, und das nicht nur im Labor in einem kleinen SoC-Fenster.
Mercedes verspricht auf dieser Basis bis zu 320 kW Ladeleistung. Damit wäre die Marke aktuell vorn dabei. Zehn Minuten sollen reichen, um im Idealfall Strom für 300 km nachzuladen. Im CLA sind zunächst 58 und 85 kWh geplant. Der Aufbau ist unterschiedlich: Die größere Batterie hat eine Siliziumoxid-Anode, die andere ist mit einer Lithium-Eisen-Phosphat-Kathode bestückt. Die Hardcase-Zellen sind in vier großen Modulen zusammengefasst und reparaturfähig.
Effizienz soll mehr Reichweite bringen
Mit der Studie Vision EQXX deutete Mercedes schon vor ein paar Jahren an, dass auf der Suche nach mehr Reichweite nicht immer größere Batterien die alleinige Lösung seien. Ein wichtiger Baustein sei die Erhöhung der Effizienz. Alle Autos auf dieser Basis bekommen deshalb eine Multi-Source-Wärmepumpe, die verschiedene Quellen nutzt, um den Innenraum möglichst schnell zu erwärmen und dazu nur ein Drittel der Energie eines konventionellen elektrischen Zuheizers benötigen soll. Durch den Wegfall der Wasserkühlung der Wärmepumpe sinkt auch das Gewicht.
Zwei Synchronmaschinen
Ungewöhnlich ist die Entscheidung von Mercedes, zwei Synchronmaschinen einzusetzen. Viele Hersteller setzen an der sekundären Achse, also der, die nicht immer zum Antrieb beiträgt, einen Asynchronmotor ein, der beim stromlosen Mitlaufen keine Schleppverluste aufbaut. Mercedes argumentiert, dass ein Synchronmotor im Betrieb effizienter sei und eine höhere Rekuperationsleistung biete. Um Schleppverluste zu vermeiden, wird der Elektromotor mit einer elektrisch aktivierten Klauenkupplung bei Bedarf vom Vortrieb getrennt. Diese Lösung ist aufwendiger als die Variante mit einem ASM, soll letztlich aber dem Verbrauch zugutekommen. Das gilt auch für das Zweigang-Getriebe an der Hinterachse, von dem sich Mercedes eine weitere Senkung des Stromverbrauchs verspricht.
Die vorläufige Spitzenversion des CLA bietet 200 kW an der Hinterachse und 80 kW an der Vorderachse. Die Systemleistung liegt bei 260 kW. Versionen mit weniger Leistung werden folgen, AMG wird oben nachlegen. Wie viel, ist ein gut gehütetes Geheimnis, allerdings wird es zunehmend schwerer, sich diesbezüglich von der Konkurrenz abzuheben. Zumal der erlebbare Mehrwert für den Kunden sich bei steigender Leistung ab einem gewissen Level kaum noch darstellt. Viele Elektroautos beschleunigen schon heute brachial, und wenn es dann noch etwas schneller geht, nähert man sich einer Grenze, ab der ein "mehr" nicht als "besser" empfunden wird.
Nur noch zwei Fahrmodi
Auf der ersten Proberunde geht es trotz schneebedeckter Fahrbahn zügig voran – nicht zuletzt dank des Allradantriebs. Es gibt nur noch zwei Fahrmodi: Comfort und Sport, das war es. Die Lenkung ist präzise und die Regelsysteme gewähren im Sportprogramm dem Heck mehr Freiheit. Aber nie so, dass es nervös erscheint. Im Gegenteil: Das ESP regelt feinfühlig. Selbst wenn man das Stabilitätsprogramm weitgehend deaktiviert (komplett abschalten lässt es sich nicht), bleibt der CLA gut berechenbar und lässt sich leicht wieder einfangen.
Die Einstellung der Rekuperation erfolgt ebenfalls über den Automatikhebel am Lenkrad: Neben einer starken Energierückgewinnung sind eine mildere, eine automatische und eine, die ein Segeln ermöglicht. Interessant ist auch das Bremsverhalten. Das Brake Control System (BCS) kommt sowohl bei den BEV- als auch den Mildhybrid-Versionen zum Einsatz und ist für alle Antriebs- und Fahrwerksvarianten der CLA-Baureihe verfügbar. Es nutze alle Aktuatoren im Auto, habe 100 Funktionen und unterstütze den Fahrer in fast allen Situationen, erklärt Techniker Philipp Neuwirth. Clou sei, dass das Bremspedal entkoppelt ist, das Bremsgefühl immer von der BCS-Einheit kommt und dadurch immer identisch sein soll. Wir können dem Prototyp ein gutes Zeugnis ausstellen. Sowohl beim vollen Stempel oder dem progressiven Verzögern bei vollbesetztem Fahrzeug bleiben der Pedalweg zum Druckpunkt und eben das Gefühl gleich.
Vorstellung: sehr bald
Die offizielle Vorstellung des CLA soll in den kommenden Wochen erfolgen. Auf die Limousine folgt der Shooting Brake, der als Kombi-Ersatz dienen soll. Zügig nachreichen wird Mercedes mehrere SUVs, die dann die aktuellen Modelle EQA und EQB beerben werden. Mit 70,5 kWh (netto) Energiegehalt stehen sie auf den ersten Blick bis heute gar nicht schlecht da. Doch die maximale DC-Ladeleistung von 100 kW deutet an, was sich seit ihrer Vorstellung im Jahr 2021 bei der Elektromobilität getan hat. Schon damals war Mercedes allerdings in dieser Hinsicht keineswegs vorn dabei. Das dürfte sich mit der MMA-Plattform des neuen CLA ändern.