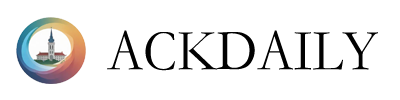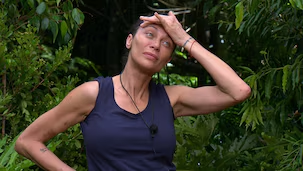Ab dem 1. März gelten in Deutschland neue Regeln für die Telemedizin. Diese werden in der "Vereinbarung über die Anforderungen für die Sicherung der Versorgungsqualität von telemedizinischen Leistungen gemäß § 87 Absatz 2o SGB V" festgeschrieben, die die Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und der GKV-Spitzenverband miteinander geschlossen haben. Mit dem Digitalgesetz (DigiG) hatte das Bundesgesundheitsministerium die Verbände zuvor verpflichtet, einheitliche Regelungen für die Videosprechstunde zu schaffen. Damit sollen die Versorgung der Patienten innerhalb dieser Sprechstunden sowie sich daran anschließende Maßnahmen verbessert werden.
Die neuen Regeln beziehen sich vor allem auf Videosprechstunden als telemedizinische Leistung zwischen Arzt und Patient sowie auf Konsilien, also telemedizinische Besprechungen zwischen verschiedenen Ärzten oder anderen Leistungserbringern. Unter anderem sollen Arztpraxen im Rahmen des medizinisch Sinnvollen Videosprechstunden anbieten. Der Zugang soll niedrigschwellig sein, und es darf nicht nach Merkmalen des Patienten wie der Art der Versicherung diskriminiert werden. Auf das Angebot der Videosprechstunde muss in den Praxisräumen hingewiesen werden.
An der kassenärztlichen Versorgung teilnehmende Fachärzte sollen ferner anderen Ärzten für Telekonsile zur Verfügung stehen, also beratend im Rahmen der Versorgung von Patienten durch andere Ärzte. Ärzte dürfen dabei Videosprechstunden auch von außerhalb ihres Praxissitzes durchführen, wenn dort ein voll ausgestatteter Telearbeitsplatz vorhanden ist, inklusive Zugriff auf die Telematik-Infrastruktur. Sie dürfen sich dabei aber nicht außerhalb Deutschlands aufhalten.
Unbekannte Patienten
Dazu kommen Regeln für unbekannte Patienten. Sie werden definiert als solche, die in den letzten vier Quartalen vor der Videosprechstunde keinen persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt in der Praxis hatten, die die Videosprechstunde durchführt. Unbekannte Patienten dürfen per Videosprechstunde keine Betäubungsmittel oder andere potenziell süchtig machende Medikamente verschrieben bekommen.
Außerdem müssen unbekannte Patienten ein sogenanntes Ersteinschätzungsverfahren durchlaufen, um Dringlichkeit nach Behandlungsbedarf einzuschätzen. Dies soll mit einer Software erfolgen.
Patienten in der Nähe bevorzugt
Ab dem 1. September müssen Patienten dann auch für die Videosprechstunde nach Dringlichkeit priorisiert werden. Zudem soll eine Praxis bevorzugt in der Nähe wohnende Patienten per Videosprechstunde behandeln. Dies soll die Anschlussversorgung verbessern. Ebenfalls sind Praxen verpflichtet, im Rahmen der Videosprechstunde die elektronische Patientenakte (ePA) zu nutzen, außer, wenn der Patient dem widersprochen hat.
Eine Einschränkung der Leistungen in der Videosprechstunde seitens der Praxis – etwa nur auf Krankschreibungen – ist nicht zulässig. Einweisungen, Überweisungen und Rezepte müssen dem Patienten noch am Tag der Videosprechstunde übermittelt oder in die Post gegeben werden.
Der Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung kritisierte die Vorgaben der Vereinbarung als Überregulierung und bezog sich hier vor allem auf die Forderung zur wohnortnahen Videosprechstunde und zur Software, mit der die Ersteinschätzung eines unbekannten Patienten erfolgen soll. Der KBV-Vorstand wies diese Kritik zurück mit dem Hinweis, dass damit nur Vorgaben aus dem Digitalgesetz umgesetzt würden.
Schrittweise Lockerungen
Die Videosprechstunde als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung gibt es in Deutschland seit 2017. Anfangs galt dies nur für sehr begrenzte Anwendungsfälle, vor allem für die Verlaufskontrolle von Verletzungen und von Erkrankungen der Haut, von Erkrankungen des Bewegungsapparates und Kontrolle des Heilungsverlaufes nach Operationen. Und in diesem engen Rahmen war die Videosprechstunde wiederum nur für solche Patienten zulässig, die der jeweilige Arzt vorher persönlich in der Praxis gesehen hatte.
Eine wesentliche Änderung gab es im Mai 2018: Der Deutsche Ärztetag beschloss, das in Deutschland immer noch gültige Fernbehandlungsverbot aufzuheben, das die Einschränkung der Videosprechstunde auf dem Arzt bekannte Patienten begründet hatte. Der Beschluss des Ärztetages wurde von den Ärztekammern der verschiedenen Bundesländer umgesetzt, und schließlich wurde im April 2019 die Videosprechstunde auch für viele andere Anwendungsfälle abrechenbar. Seit Oktober 2019 ist auch der Erstkontakt eines Patienten mit dem Arzt per Videosprechstunde abrechenbar.
Weiter wurden die Regelungen im Rahmen der Corona-Pandemie gelockert: Hier gab es zusätzliche Vergütung als Anschubfinanzierung für Praxen, die die Videosprechstunde einführten, und eine Aufhebung der zuvor geltenden Mengenbegrenzung.