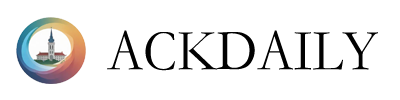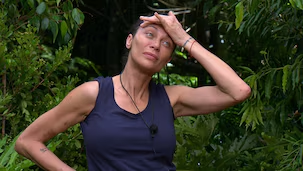Die Nachricht, die zeigt, wie sehr der Stern des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gerade im Sinkflug ist, wurde in der Ukraine achselzuckend zur Kenntnis genommen, in Westeuropa fiel sie beinahe ganz unter den Tisch: Vor genau drei Jahren hatte Russland seinen Angriff auf die Ukraine begonnen.
Zu diesem Anlass wollte das ukrainische Parlament zu Beginn dieser Woche eine Resolution zur Unterstützung seines Präsidenten verabschieden. Doch das Vorhaben scheiterte – auch an der mangelnden Bereitschaft von Selenskyjs eigenen Parteifreunden, hier mitzumachen.
Der Lack bei Selenskyj ist ab
Der Fall zeigt: Seitdem die USA nicht mehr ins gleiche Horn stoßen wie Westeuropa und Selenskyj einmütig zum Helden stilisieren, der sich einer imperialistischen Großmacht namens Russland entgegenstellt, ist der Lack ab. Die ersten graben wieder tiefer und entdecken von neuem, dass der Kriegsheld seine dunkleren Seiten hat.
Das passiert zuallererst in der Ukraine selbst. Noch im vergangenen Frühjahr, als die reguläre Amtszeit Selenskyjs als Präsident abgelaufen war, er aber wegen des verhängten Kriegsrechts keine Wahlen abhalten durfte, ergaben Umfragen, dass rund zwei Drittel der Ukrainer hinter ihrem Präsidenten standen.
Resolution ist knapp durchgefallen
Genau das sollte die jetzt durchgefallene Resolution erneut zum Ausdruck bringen. In dem Papier heißt es, dass Selenskyjs Mandat vom ukrainischen „Volk und der obersten Rada nicht in Zweifel gezogen“ werde. Und der Präsident in „freien Wahlen gewählt wurde“. Die Rada ist das gesetzgebende Organ im Einkammersystem der Ukraine.
Doch der Satz und damit die Resolution fielen knapp durch. 218 der 450 Abgeordneten stimmten zu. 226 Stimmen wären notwendig gewesen. Selbst von Selenskyjs Partei „Diener des Volkes“ beteiligten sich 38 Mitglieder nicht an der Abstimmung. Das Ganze geschah, vor den Augen der EU-Kommission, die zu der Abstimmung eigens eine Abordnung entsandt hatte, was den Eklat perfekt machte.
Echte Wahlen gibt es in der Ukraine nicht
Echte Wahlen gibt es in der Ukraine seit Kriegsausbruch nicht. Es herrscht Kriegsrecht, was keine Wahlen vorsieht und es wäre auch logistisch schwierig, jene Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, die ins Ausland geflohen sind, an die Wahlurne zu bekommen.
Dass jedoch im Krieg erfolgreiche Politiker in einem Frieden abgewählt werden, wäre kein Schicksal, das Selenskyj allein treffen würde. Historisches Beispiel ist etwa der britische Kriegspremier Winston Churchill, der unmittelbar nach dem Sieg der Alliierten über Deutschland von seinen Wählern in die Wüste geschickt worden war.
„Ich brauche Munition und keine Mitfahrgelegenheit“
Selenskyj hat zwar bislang keinen Sieg errungen, aber ihm gebührt die Anerkennung dafür, dass er seit drei Jahren erfolgreich den ukrainischen Widerstand gegen eine übermächtige russische Armee vor allem dadurch organisiert, dass er weltweit Verbündete und damit Geld- und Waffenlieferanten auftut.
Sein prägnantester Satz fiel 48 Stunden nach dem russischen Angriff, als ihm Amerikaner angeblich angeboten haben sollen, ihn und seine Familie außer Landes zu bringen: „Ich brauche Munition und keine Mitfahrgelegenheit“ soll er gesagt haben. Der Satz zeigt den fundamentalen Unterschied zwischen Selenskyj und seinem Widersacher Wladimir Putin. Der eine kann den Krieg gewinnen, der andere gewinnt den Propaganda-Feldzug, in dem er eine breite Welle der Sympathie für sich schafft.
„Pandora Papers“ belasten Selenskyj
Verdrängte Erinnerungen werden dennoch wach: Als im Jahr 2021 die „Pandora Papers“ Kleptokraten in aller Welt demaskierten, stand die Ukraine auf dem ersten Platz bei der Zahl korrupter Amtsträger. Einer von ihnen war Selenskyj mit Konten in Belize, Zypern und auf den Britischen Jungferninseln. 41 Millionen Dollar soll er bekommen haben, überwiesen von dem Oligarchen Ihor Kolomojskyj.
Die Rechercheergebnisse eines internationalen Journalistennetzwerks umfassten damals die Verstrickung von mehr als 330 Politikern und Amtsträgern aus 91 Ländern. Die mehr als 11,9 Millionen geleakten Dokumente trugen den Namen „Pandora Papers“ und stammen angeblich aus einer anonymen Quelle. In den Dokumenten von 14 in Steueroasen tätigen Finanzdienstleistern finden sich auch Namen von prominenten Spitzensportlern und Firmenvorständen.
Vermögen wurden eingefroren
Die Veröffentlichungen warfen ein schlechtes Licht auf die Ukraine. Gleich 38 Ukrainer, wurden in den Pandora Papers genannt. Unter ihnen eben Selenskyj selbst. Der Vorwurf: Kaum im Amt, ging der Ex-Kabarettist auf mehrere Oligarchen los, fror Vermögen ein, schickte Ermittler.
Einer der bekanntesten ukrainischen Oligarchen aber kam erstaunlich ungeschoren davon: Kolomoisky, ein in Genf und Israel lebender ukrainischer Oligarch. Er und seine Familie besitzen am Genfersee mehrere Luxusimmobilien. Das Magazin „Forbes“ schätzt sein Vermögen auf etwa zwei Milliarden Franken. Er hat Selenskyj in dessen Wahlkampf 2019 unterstützt. Ukrainische Zeitungen schrieben damals, dass Selenskyj seinen Förderer mehrmals in Tel Aviv und in Genf besucht habe.
Millionen Dollar der PrivatBank flossen an Briefkastenfirmen
Kolomoisky soll mit einem Geschäftspartner mehr als fünf Milliarden Franken aus der „PrivatBank“ abgezweigt haben, die den beiden gehörte. In Großbritannien, Zypern, Israel und den USA wurde Kolomoisky darauf von seiner Ex-Bank verklagt. Im März 2021 verhängte das US-Außenministerium Sanktionen wegen des Vorwurfs schwerwiegender Korruption: Kolomoisky und seine Familie dürfen seither nicht mehr in die USA einreisen. Kolomoisky dementiert alle Vorwürfe.
Mehrere Millionen Dollar der Bank flossen an Briefkastenfirmen in Zypern, Panama, Belize und auf den Seychellen. Daten aus den Pandora Papers zeigten: Hinter zehn jener Briefkastenfirmen standen Selenskyj und gute Freunde von ihm: sein ehemaliger Produzent Serhiy Schefir, der zu seinem Chefsekretär aufgestiegen ist, sowie der damalige Chef des Inlandsgeheimdienstes, Iwan Bakanow. Zwei der Offshore-Gesellschaften erwarben Immobilien im Stadtzentrum von London.
Selenskyj übertrug Anteile
Woher die Millionen für den Kauf stammten, ist unklar. Weder Selenskyj noch Bakanow reagierten damals auf Fragen. Auch Schefir, der im September 2021 einen Mordanschlag überlebt hatte, ließ Nachfragen damals unbeantwortet. Rein formell wurde Selenskyj die Anteile an den Briefkastenfirmen rechtzeitig wieder los, bevor er in den Präsidentenpalast einzog. Er übertrug die Anteile einer Firma an seinen Freund Schefir, der anders als der Präsident Vermögenswerte und Geschäftsverbindungen nicht offenlegen muss.
Dazu passen die Ergebnisse eines EU-Sonderberichts „zur Bekämpfung der Großkorruption in der Ukraine“ aus dem Jahr 2021, der seither nur noch ganz selten thematisiert wurde. Darin stellen die Autoren fest, dass Großkorruption, also die Verwicklung hoher Würdenträger aus Staat und Wirtschaft in kriminelle Geschäfte, „nach wie vor ein zentrales Problem in der Ukraine“ sei.
„Nur vereinzelte Verurteilungen wegen Großkorruption“
Eine Justizreform habe Rückschläge erlitten und die Korruptionsbekämpfungseinrichtungen seien gefährdet. Nur „vereinzelt kommt es zu Verurteilungen wegen Großkorruption“, stellen die Sonderberichterstatter fest. „In der Ukraine beruht dies auf informellen Verbindungen zwischen Regierungsbeamten, Parlamentsmitgliedern, Staatsanwälten, Richtern, Strafverfolgungsbehörden, Geschäftsführern von staatseigenen Unternehmen, politisch vernetzten Einzelpersonen und Unternehmen.“